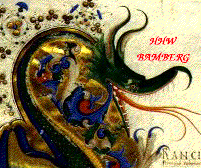
Ermittlung von Fälschungen im Mittelalter
Erkannt wurden Fälschungen an äußeren und inneren
Merkmalen. Schriftvergleichung war schon ein Kriterium des
römischen Rechts gewesen ( C 4.21.20 ), und die comparatio
litterarum wurde später auch von den mittelalterlichen
Juristen zur Kommentierung von X 5.20.5 herangezogen, der Dekretale Innocenz III., in
welcher der Papst einen Katalog von Kriterien zur Beurteilung von Fälschungen
aufgestellt hat.
Auch sonstige äußere Auffälligkeiten wurden
bemerkt. So erkannte Alexander III. im Jahre 1176 (Anm.) eine Interpolation auf einer
Rasur in einer Urkunde Eugens III., die ihm vorgelegt worden war, um
nachzuweisen , daß die Michaelskirche auf dem Monte Gargano ein
mit Siponto unierter Bistumssitz gewesen sei. Überhaupt ist
Alexander III. mehrfach als Urkundenkritiker nachweisbar. Das
von ihm befolgte Verfahren ist genauer zu erkennen im Streit zwischen
Bischof Petrus von Pamplona und San Salvador de Leire, wo der Bischof
eingewandt hatte, das von der Gegenseite vorgelegte Exemptionsprivileg
Alexanders II. sei gefälscht. Petrus war hier zwar auf der
richtigen Fährte, denn die Urkunde Alexanders II. ist
tatsächlich nach unserem Kenntnisstand eine Fälschung (Anm.2), doch
der Papst hat sich seinem Verdacht nicht angeschlossen. Nec ex
stilo dictaminis nec ex bulla aut scriptura sei zu erkennen,
quod aliquid falsitatis in se continent.(Anm.3) Weder das Diktat noch
die Schrift oder die Bullierung wurden also als regelwidrig erkannt,
als die fraglichen Urkunden an der Kurie zur Prüfung vorgelegt
wurden. Wie aus dem Schreiben des Papstes an den Kardinallegaten
Iacintus, den späteren Cölestin III., hervorgeht , waren die
Dokumente mit Urkunden in Montecassino verglichen worden.(Anm.4) Daß
nicht jede Abweichung gleich zu einer Verwerfung führen
mußte, erklärt Alexander III. hinsichtlich der Indiktion,
die zwar nicht mit anderen Stücken Alexanders II.
übereinstimme : cum, sicut nosti, ecclesia Romana non consuevit
in huiusmodi articulis privilegia infringere vel reprobare. Dies
bedeutet, daß man sich der legitimen Möglichkeit von
kleineren Varianten bewußt war. In dem an die Kläger
gerichteten Schreiben wird die Prüfung der Urkunden ebenfalls
erwähnt, jedoch ohne Angabe von Einzelheiten.(Anm.5)
Dabei ist
interessant, daß Vergleichsmaterial an der Kurie unmittelbar
nicht zur Verfügung stand. Dies ergibt sich auch aus einer
Geschichte, die ein Zeuge im Verlauf der Untersuchung erzählt, die
der Kardinallegat Laborans im Streit zwischen den Bistümern Arezzo
und Siena durchgeführt hat(Anm. 6). Auch eine kritische Beurteilung von
Privaturkunden wurde von der römischen Kurie vorgenommen. In
einem Prozeß zwischen dem Bischof von Nicastro und dem
griechischen Kloster S. Maria del Carrà, der vor dem
Kardinalbischof von Albano durchgeführt wurde, hatten die
Prokuratoren des Bischofs eine Sentenz vorgelegt, die von Bischof J.
von Mileto und Abt Joachim von Corazzo (=Joachim von Fiore) ausgestellt
worden war. Da diese Urkunde anscheinend wegen des Fehlens der
Besiegelung und weil sie nicht von einem öffentlichen Notar
geschrieben war (Sed quia nec munitum erat sigillo eorum nec publica
manu factum) , nicht als beweiskräftig angesehen wurde,
erboten sich die Prokuratoren, die Richtigkeit der Sache durch
über jeden Verdacht erhabene Zeugen aus ihrem Gebiet (per
testes omni exceptione maiores in suis partibus ) zu beweisen. Der
Bericht darüber findet sich in einer Urkunde Honorius III. vom
1. Juni 1219.(Anm.7)
H.U. Kantorowicz, Schriftvergleichung und Urkundenfälschung. Beitrag zur
Geschichte der Diplomatik im Mittelalter, in QF 9, 1906, 38 - 56, behandelt
Beispiele aus Verfahren vor Albertus Gandinus in Bologna im Jahre 1289.
Hans Foerster, Beispiele mittelalterlicher Urkundenkritik, in AZ 50/51,
1955, 301 - 318.
Anm. 1) It.Pont. IX, 238 f. Nr.22. zurück
Anm. 2) Paul Fridolin Kehr, Papsturkunden
in Spanien II, Nr. 2
Anm. 3) Paul Fridolin Kehr, Papsturkunden
in Spanien II, Nr. 134
Anm. 4) Paul Fridolin Kehr, Papsturkunden
in Spanien II, Nr. 135
Anm. 5) Paul Fridolin Kehr, Papsturkunden
in Spanien II, Nr. 137
Anm. 6) Ubaldo Pasqui: Documenti per la storia della
città di Arezzo nel Medio Evo. Vol. 2.: Codice diplomatico (anno
1180-1337), Arezzo 1916, S. 534 in der Zeugenaussage des Baccalarinus,
Bürgers von Arezzo, der über Erlebnisse seines Vaters Guilielminus
berichtet: Erat enim pater meus litteratus.
Anm. 7) Pontificia Commissio ad redigendum codicem iuris
canonici orientalis. Fontes. Series III, vol. III, S. 89-92 Nr. 64;
vgl. Norbert Kamp, Kirche und Monarchie S. 817f.
Ertappte Fälscher in Mittelalter und Neuzeit
Nachrichten über Fälscher und Fälschungen und ihre
Entlarvung haben wir schon früh. So berichtet Gregor von Tours, der
Referendar habe von dem Bischof Egidius von Reims vorgelegte Urkunden als
Fälschungen erkannt, worauf sich der Bischof selbst als
Majestätsverbrecher bekannte und zur Strafe geblendet wurde.
Daß Bischöfe häufiger als Fälscher
nachzuweisen sind, dürfte nicht mit einer besonderen Neigung ihres
Standes zusammenhängen, sondern damit, daß für sie die
Überlieferung unserer Quellen reichhaltiger ist als für andere
Personengruppen. Außerdem verfügten sie, da sie selbst als
Urkundenaussteller auftraten, über die nötigen Hilfsmittel und
Mitarbeiter. So wird in dem Absetzungsverfahren, das Innocenz III. gegen
den Bischof von Vieste durchführen ließ, der Vorwurf erhoben,
daß der Bischof sein Kapitel vor dem kaiserlichen Gericht angeklagt
und gegen den Archidiakon Urkunden gefälscht habe, was zu dessen
Amtsverlust geführt habe: Reg. Inn.III, I,1: ... de clericis in
curia imperiali deposuisse querelas et contra sepedictum archidiaconum
falsas litteras confinxisse, occasione quarum ipsum archidiaconatus
beneficio et loco nequiter multo tempore spoliavit..(01)
Gegen den Minoriten Rogerius, Bischof von Bovino seit 1329, wurde der
Verdacht der Fälschung von Urkunden König Roberts von Sizilien
verbreitet, weswegen Johann XXII. den Erzbischof von Neapel 1334 mit einer
vorsichtigen Untersuchung des Falles beauftragte (1). Da von späteren Zwangsmaßnahmen nichts
bekannt ist, dürfte sich die Haltlosigkeit der Vorwürfe erwiesen
haben.
In den Registern Johanns XXII. betreffen über
vierzig Urkunden Fälscher von Papsturkunden (2) .
1286 erließ Honorius IV. ein Reskript gegen den Priester Petrus
dictus Tyes aus der Diözese Sens, der sich mit Hilfe gefälschter
Briefe auf den Namen Martins IV. als apostolischer Nuntius für England
ausgegeben und Prokurationsleistungen erschwindelt hatte (3).
Die Häufigkeit von
erkannten Fälschungen führte auch zur Aufnahme entsprechender
Muster in Formelsammlungen, allerdings nicht in der Sammlung des
Kanzleibuches, sondern im Formelbuch der päpstlichen
Pönitentiarie (4). Dabei
liegt allerdings ein relativ einfacher Fall zugrunde. Ein armer Kleriker
hatte bekannt, daß er in einer Urkunde des verstorbenen Papstes H.,
vermutlich Honorius III., auf Betreiben eines Genossen eine Rasur
vorgenommen und an Stelle eines quinto ein quarto gesetzt habe. In
Unkenntnis dessen, daß er dadurch der Exkommunikation verfallen sei,
habe er danach Subdiakonats- und Diakonatsweihe empfangen, ohne vorher die
Absolution zu erlangen. Nach Erkenntnis seiner Schuld habe er sich an den
Papst um Absolution gewandt und diese schließlich durch den
Pönitentiar erhalten. Dabei war der Erzbischof von Rouen um einen
schriftlichen Bericht de vita et moribus des Übeltäters
gebeten worden, nach dessen Vorliegen der Erzbischof den Auftrag erhielt,
den Täter von seinen bisher erlangten ordines zu suspendieren und ihm
den Zugang zu weiteren Weihen zu untersagen (5).
In der Kanzleiordnung Nikolaus III. wurde festgelegt, daß
Urkunden gegen Fälscher von Papsturkunden künftig der Kontrolle
durch Verlesung vor dem Vizekanzler unterworfen werden sollten, nachdem sie
bis dahin anscheinend zu den litterae dandae gehört hatten (6). Diese frühere Zuordnung
spricht dafür, daß derartige Fälle als
Routineangelegenheiten angesehen wurden, also relativ häufig gewesen
sein mußten. Die Veränderung unter Nikolaus III. bedeutet nun
allerdings nicht, daß Fälschungen etwa schlagartig seltener
geworden wären, sondern zeigt ein verändertes
Verantwortungsbewußtsein des Papstes, der sich nun zwar nicht direkt
persönlich mit diesem Mißbrauch seines Namens auseinandersetzen
wollte, aber doch den Leiter der Kanzlei damit beauftragte.
Fälschungen waren nicht auf das Mittelalter beschränkt und
nicht nicht immer auf unmittelbaren materiellen Gewinn ausgerichtet. Neben
der schon klassischen "feststellenden" Fälschung, die darauf
abzielte, an sich vorhandene tatsächliche Rechtstitel, deren
Originalfassung aus irgendwelchen Gründen verloren gegangen war,
wieder in vorzeigbare schriftliche Form zu bringen gab es politisch
motivierte Spuria wie die Österreichischen Freiheitsbriefe, deren
Unechtheit schon Lorenzo Valla erkannte, die aber dennoch zur
Einbürgerung des Titels eines archidux für den Herzog von
Österreich führten (6a). In der Neuzeit spielt vor allem
genealogisches Interesse bzw. die Notwendigkeit, Lücken im Stammbaum
bei einer Adelsprobe zu schließen, eine Rolle, aber auch Gelehrte
schreckten nicht immer davor zurück, ihre Quellennachweise selbst
herzustellen. Die Herstellung eines spätantiken Militärdiploms
durch Absolventen des Instituts für Österreichische
Geschichtsforschung diente wohl vor allem dazu, sich für die
vielleicht zu ausgedehnte Lektüre von Beispielen älterer und
jüngerer römischer Kursive zu revanchieren.
Überall, wo Urkunden in Gebrauch waren, gab es auch das
Phänomen der Urkundenfälschung. Das Delikt ist auch im
modernen Strafrecht noch vorgesehen, allerdings bei deutlich geringerem
Strafrahmen, vor allem, wenn man ihn mit den Bestimmungen gegen
Fälscher von Königs- bzw. Kaiserurkunden vergleicht, die als
Majestätsverbrecher angesehen und deshalb mit Kapitalstrafen bedroht
wurden. Fälschungen sind kein Privileg des abendländischen
Kulturkreises und des byzantinischen Reiches. Ein als gefälscht
erkanntes Privileg des Propheten Mohammed wiesen verschiedene jüdische
Gemeinden des Mittelalters vor, um eine Befreiung von der islamischen
Kopfsteuer zu erlangen. Der Vertrag mit dem Propheten scheint in
verschiedenen Versionen im Umlauf gewesen zu sein, von denen sich eine aus
der Kairoer Geniza im Wortlaut erhalten hat. Verschiedene islamische
Rechtsgelehrte haben den jeweils vorgelegten Vertrag als Fälschung
erkannt, wobei bei der Beurteilung vor allem irrige Zeugennamen eine Rolle
spielen. Die eingehendste Widerlegung mit modern anmutendem methodischem
Vorgehen in Art des Diplomatikers stammt von Ibn Taimiyya (1263 - 1328).
An äußeren Merkmalen untersuchte er die Schrift, die nach seinen
Ergebnissen von verschiedenen Händen stammte und somit nicht von dem
als Schreiber genannten Ali sein konnte. Daneben monierte Ibn Taimiyya
Verstöße gegen die arabische Hochsprache sowie unpassende
Grußformeln, außerdem verrieten ihm rechtshistorische
Anachronismen die Fiktion. Auch er stellte Fehler in der Zeugenliste fest,
außerdem führte er einen Stil- und Diktatvergleich mit echten
Verträgen des Propheten durch, die leider nicht genauer angegeben
werden. Ferner fragte er nach Überlieferung und Funktion der
Fälschung, die erstmals rund 300 Jahre nach dem angeblichen
Abschluß des Vertrages zwischen den Juden von Haibar und dem
Propheten vorgewiesen wurde. Bei der Untersuchung der Urkunde können
wir also deutliche Parallelen zur Vorgehensweise etwa der Päpste
erkennen (7).
Anmerkungen:
01)Kamp, Kirche und Monarchie S. 541; vgl. auch It. Pont. IX, 269f. Nr.
3*-5*
1) Reg.Vat. 117, fol.230r. (zurück)
2) Reg. Jean XXII Nr. 2136, 5318, 5319, 5493, 10134, 10297, 10418, 10923,
11149, 11541, 11738, 12057-12060ter, 13148, 13493, 13548, 13819, 14039,
14292, 15064, 17093, 17882, 18084, 19335, 20316, 22279, 22443, 23129,
25991, 26119, 26395, 27167, 28627, 29655, 29656, 29678, 29937, 40623,
50710, 51567, 51839, 58033, 58206, 58209, 58261, 60971. (zurück)
3) Reg. Honorius IV, 348 Nr.493. (zurück)
4) H.Ch.Lea, A Formulary of the Papal Penitentiary in the Thirteenth
Century, Philadelphia 1892.(zurück)
5 ) Nr. 48 bei Lea. (zurück)
6) Tangl, Kanzleiordnungen 80 §72. (zurück)
6a) Eva Schlotheuber: Das Privilegium maius - eine habsburgische
Fälschung im Ringen um Rang und Einfluss - In: Schmid, Peter –
Wanderwitz, Heinrich [Hrsg.] , Die Geburt Österreichs. 850 Jahre
Privilegium minus - Regensburg (2007), S. 143-165
7 ) vgl. Albrecht Noth, Minderheiten als Vertragspartner im Disput mit dem
islamischen Gesetz, in : Studien zur Geschichte und Kultur des Vorderen
Orients. Festschrift für Bertold Spuler zum siebzigsten Geburtstag,
Leiden 1981, 289 - 309; außerdem Majer, Hans Georg: Über Urkundenfälschung im Osmanischen Reich
- In: Costantini, Vera [Hrsg.] : Living in the Ottoman ecumenical community: essays in honour of Suraiya Faroqhi - Leiden 2008, S. 45-70
(zurück)
Bibliographische
Hinweise
Die Fassung vom 27. Mai 2007, verbunden mit den bibliographischen
Hinweisen, kann als docx heruntergeladen werden.
© Horst Enzensberger 2003
Letzte Änderung am November 15, 2022